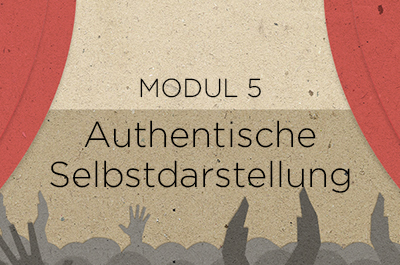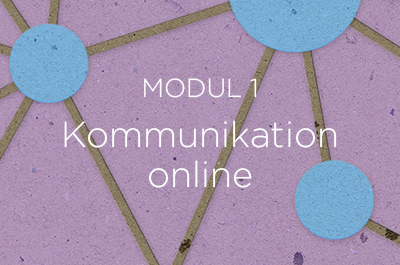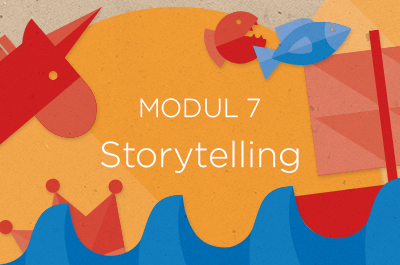MODUL 2: Identität riskieren
1. Case → 2. Insight → 3. Deep Lecture
Wer nichts waget,
der darf nichts hoffen
– Friedrich Schiller
Selbstdarstellung in Social Media läuft immer Gefahr, auf Widerspruch, Ablehnung und Konflikt zu treffen. Das kann auch mit der besten Kommunikationsstrategie passieren. Über das Corporate Image entscheidet die Community, nicht der Social-Media-Manager allein. Die wichtigste Investition in diesen Kanal ist deshalb Mut.
von Simon Noack und Stephan Frühwirt
Kommunikation unter Anwesenden
Wer Social Media nutzt, nimmt an Interaktion teil. Interaktion ist Kommunikation unter Anwesenden. Dabei kann Anwesenheit online natürlich nicht die physische Präsenz der Beteiligten und auch nicht deren synchronisierte Aufmerksamkeit meinen. Damit Kommunikationsteilnehmer die Bedingung der Anwesenheit erfüllen, ist es stattdessen notwendig, dass sie antworten können und dadurch für andere sichtbar werden. Das ist mit Social Media trotz zeitlicher und räumlicher Differenzen möglich. Denn als Telekommunikationsmedien erlauben sie zeitlich versetzte Anschlusskommunikation von fast jedem Ort der Welt aus.
Man lernt sich kennen
In Social Media können sich die Beteiligten also durch kontinuierliche Anwesenheit einbringen und als Personen sichtbar werden. Jede Kommunikation wird einem Teilnehmer zugerechnet und sagt etwas über diesen aus. Auf diese Weise erfahren die anderen im Laufe der Interaktion immer mehr über ihn, lernen seine Motive und Interessen kennen und können ihn zunehmend besser einschätzen: Welche Themen interessieren ihn? Auf welche Inhalte lässt er sich ein und auf welche eher nicht? Worauf reagiert er empfindlich?
Black Boxes
Mit solchen Erfahrungen wird eine grundlegende Unsicherheit reduziert, durch die jede Kommunikation, ja jede soziale Situation überhaupt gekennzeichnet ist und die soziologisch auch als doppelte Kontingenz bezeichnet wird: Personen handeln „kontingent“, also so, dass es immer auch anders möglich wäre. Sie sind füreinander Black Boxes, deren Verhalten unvorhersehbar ist. Das erzeugt Hemmnisse und Schwierigkeiten: Wer soll in einer solchen Situation einen ersten Schritt wagen, wenn er nicht weiß, wie der andere darauf reagieren wird?
Sich kennenlernen heißt Erwartungen bilden
In dieser zunächst symmetrischen Situation wird jedes Verhalten zur Grundlage der Einschätzung eines anderen. Alles, was dieser tut, ist relevant, wird als Information über ihn gewertet, trägt zur Erfahrung mit ihm bei: Jemand lädt ein Profilbild hoch, schreibt einen Kommentar oder bewertet einen Beitrag positiv und gibt damit etwas über sich preis. Sofort wird er als ein Gegenüber sichtbar und an die Stelle der Unsicherheiten treten konkrete Erwartungen. Personen können deshalb auch als “Erwartungshorizonte” beschrieben werden: Sie lassen durch ihre bisherige Kommunikation auf ein bestimmtes zukünftiges Verhalten schließen. Man kommuniziert so und nicht anders, wählt dieses, aber nicht jenes Thema, könnte vieles tun, entscheidet sich aber so. Nach einiger Zeit wissen die anderen, mit wem sie es zu tun haben und mit was sie rechnen müssen oder können. Das kann zur Bildung von Sozialkapital führen: Manche können sich zu bestimmten Themen als Experten etablieren, als Autoritäten, denen andere Vertrauen und Anerkennung schenken.
Unvermeidbare Kommunikationsrisiken
Dieser Prozess der Bildung von Erwartungen läuft jedoch für gewöhnlich nicht reibungsfrei ab. Nicht alles stößt bei anderen auf Zustimmung, bestimmte Verhaltensweisen und Entscheidungen werden strikt abgelehnt. Andere kennenzulernen bedeutet immer auch, ihnen Grenzen zu setzen und selbst welche zu akzeptieren. Mit der Art, wie jemand kommuniziert, präsentiert er sich anderen, legt sich selbst fest, ohne jedoch dabei wissen zu können, wie diese darauf reagieren werden. Das ist riskant, aber unumgänglich. Unsicherheitsabsorption ist ohne Erzeugung von Konfliktpotenzialen nicht möglich.
All dies gilt in Social Media auch für Organisationen. Auch sie werden als ein Gegenüber erlebt, mit dem andere Erfahrungen machen, die zu Erwartungen und möglicherweise auch zur Bildung von Vertrauen führen können. Und auch sie erzeugen Konfliktpotenziale: Akzeptieren die Zielgruppen die gewählte Selbstdarstellung oder ist mit Irritation und Widerspruch zu rechnen? Eine gut ausgearbeitete Corporate Identity hat noch lange nicht das entsprechende Corporate Image zur Folge. Neben #weilwirdichlieben haben genau dies zahlreiche Social-Media-Kampagnen schon häufig bewiesen.
#myNYPD
Do you have a photo w/ a member of the NYPD? Tweet us & tag it #myNYPD. It may be featured on our Facebook. pic.twitter.com/mE2c3oSmm6
— NYPD NEWS (@NYPDnews) 22. April 2014Post: NYPDnews, Quelle
Im April 2014 rief das NYPD die Bürger New Yorks dazu auf, gemeinsame Fotos mit Polizisten zu veröffentlichen. Unter dem Hashtag #myNYPD sollten freundliche Gruppenbilder gesammelt werden, um das Image einer bürgernahen Polizei zu unterstützen.
Sure thing! MT @NYPDnews: Do you have a photo w/ a member of the NYPD? Tweet us & tag it #myNYPD pic.twitter.com/mdWqoHiij5
— DefendedInTheStreets (@KimaniFilm) 22. April 2014Post: KimaniFilm, Quelle
Dem Aufruf wurde zahlreich Folge geleistet. Anstatt freundlicher Gruppenbilder erhielt das NYPD allerdings eine Flut von Aufnahmen gewalttätiger Polizisten – nicht unbedingt das, was sich die Verantwortlichen erhofft hatten.
So wurde aus dem Hashtag ein sogenanntes „Bashtag”. Ein typischer Fall enttäuschter Erwartungen.
Cat Content: Keine Dauerlösung
Es wäre ein Fehler, Enttäuschungen durch eine möglichst gefällige Kommunikation vorbeugen zu wollen. Ausschließlich Inhalte zu veröffentlichen, die thematisch so allgemein wie nur irgend möglich gewählt sind, und damit auf Akzeptanz bei den Nutzern zu hoffen, mag zwar das Risiko heftiger Konflikte verringern, doch lassen sich mit Gemeinplätzen auch kaum Unique Selling Propositions kommunizieren.

Cat Content: Allseits beliebt, jedoch kaum in der Lage, USP zu kommunizieren
Foto: Shanon, Quelle, Lizenz: CC0 Public Domain
Bestimmen und bestimmen lassen
Deshalb ist es für jene, die sich deutlich positionieren wollen, wichtig, den Gedanken aufzugeben, sie könnten Widersprüche und Ablehnung prinzipiell vermeiden. Interaktion in Social Media lässt sich nicht nach individuellen Vorstellungen bestimmen. Kommunikation unter Anwesenden ist ein Gemeinschaftsprojekt, bei dem sich jeder auch zu einem guten Teil bestimmen lassen muss. Auch Autoritäten und Experten brauchen immer die Anerkennung der anderen. Ein guter Social-Media-Manager weiß deshalb, dass er nur gut ist, wenn er kein Social-Media-Manager ist. Es ist nur allzu nachvollziehbar, dass diese Perspektive für Organisationen schwierig ist. Sie sind es gewohnt, Entscheidungen zu treffen, nach denen ihre Mitglieder sich zu richten haben. Aber Fans auf Facebook und Follower auf Twitter sind keine Mitglieder. Ihnen auf Augenhöhe zu begegnen erfordert Mut – den Mut, die Abhängigkeit der Selbstdarstellung von der Fremdwahrnehmung durch andere nicht als Problem, sondern als Chance zu erleben.